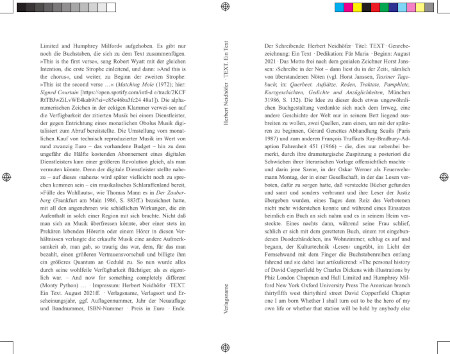 ↑
↑
Herbert Neidhöfer, homme de lettres
Home · Das Projekt · Bilder · Verweise · Von der Westküste · Kontakt / Impressum
Die Clemens Limbularius Trilogie · ¡Hans Koberlin vive! · TEXT. Ein Text
»The personal history of David Copperfield by Charles Dickens with illustrations by Phiz London Chapman and Hall Limited and Humphrey Milford New York Oxford University Press The American branch thirtyfifth west thirtythird street David Copperfield Chapter one I am born Whether I shall turn out to be the hero of my own life or whether that station will be held by anybody else these pages must show.« (François Truffaut, Fahrenheit 451 (1966), nach dem Roman von Ray Bradbury).
TEXT
Ein Text
Für Maria
August
2021ff.
Was Sie hier lesen können, das ist das bereits im August des Jahres 2021 eingerichtete Projekt, dem sich nach Vollendung (!) von ¡Hans Koberlin vive! in einer noch fernen Zukunft ausschließlich gewidmet werden soll, und es soll kein Roman mehr sein, sondern es soll, wie Titel und Genrebezeichnung, die hier immer zusammen auftreten müssen, versprechen, ein Text sein und es soll ohne Fußnoten sein und es soll ein Wein sein und mir wern nimmer sein. Wer mag kann den Text als den Text betrachten, den Hans Köberlin in seinem Exil an der weißen Küste zu schreiben begonnen hat.
»Und wozu noch eine Einheit festhalten, wenn sie dem Beobachter nur als Paradox erscheinen kann?« (Niklas Luhmann, »Ohne Titel« – wie so? »… die andere Seite der Selbstreferenz, die Fremdreferenz«; in: Schriften zu Kunst und Literatur, Frankfurt am Main 2008, S. 296).
Ungeduld war der Beweggrund, den bereits produzierten Text hier und nun zu plazieren. Der bereits produzierte Text unterliegt allerdings einer ständigen Überarbeitung und hat somit den Charakter von Borgesʼ libro de arena: zwar nicht jedes Mal, wenn Sie diese Seite besuchen, aber ab und an wird nicht mehr genau das da stehen, was Sie das vorherige Mal gelesen haben. Ruhe wird es erst nach dem Ende geben.
»Und zwischendurch sage ich mir: das läuft da heutzutage alles so eilig nach vorwärts – da gehst du selber ab besten gleich rückwärts.« (Horst Janssen, Rede Mannheim – Zur Verleihung des Schiller-Preises; in: Querbeet. Aufsätze, Reden, Traktate, Pamphlete, Kurzgeschichten, Gedichte und Anzüglichkeiten, München, 3. Auflage 1986, S. 302).
*
Der Schreibende: Herbert Neidhöfer · Der Titel: TEXT · Die Genrebezeichnung: Ein Text · gegebenenfalls die Nummer des Bandes · Die Dedikation ist: Für Maria · Beginn: August 2021 · Das Motto Nummer eins ist, frei nach dem genialen Zeichner Horst Janssen: ›Schreibe in der Not – dann liest du in der Zeit‹, nämlich von überstandenen Nöten (vgl. Horst Janssen, Tessiner Tagebuch; in: Querbeet. Aufsätze, Reden, Traktate, Pamphlete, Kurzgeschichten, Gedichte und Anzüglichkeiten, München, 3. Auflage 1986, S. 132). – Aber warum gleich wieder mit Not und Nöten anfangen? Das scheint eine schlechte Angewohnheit zu sein, hier muß ein anderes, noch zu findendes erstes Motto hin. Das Motto Nummer zwei stammt aus Niklas Luhmanns zweitem Zettelkasten: »Sie bekommen alles zu sehen, und nichts als das – wie beim Pornofilm.« (Zettel 9/8,3). Und das Motto Nummer drei kommt natürlich von Robert Walser: »Endlich bin ich befreit, ich juble, und wenn ich nicht juble, so lache ich, und wenn ich nicht lache, so atme ich auf, und wenn ich nicht aufatme, so reibe ich mir die Hände …« (Robert Walser, Das letzte Prosastück; in: Sämtliche Werke in Einzelausgaben, hrsg. von Jochen Greven, Bd. 16: Träumen, Frankfurt am Main 1986, S. 325). Die Idee zu dieser doch etwas ungewöhnlichen Buchgestaltung* verdankte sich – nach dem juvenalen Irrweg, ausgehend von der Überdeterminierung jeder einzelnen Geschichte eine andere Geschichte der Welt nur im Bett liegend ausbreiten zu wollen – zwei Quellen, zum einen, um mit der späteren zu beginnen, Gérard Genettes Abhandlung Seuils (Paris 1987) und zum anderen François Truffauts Ray-Bradbury-Adaption Fahrenheit 451 (1966) – die, dies nur nebenbei bemerkt, durch ihre dramaturgische Zuspitzung a posteriori die Schwächen ihrer literarischen Vorlage offensichtlich machte, Perec, auch dies nur nochmals nebenbei, mochte Bradbury auch nicht, siehe Georges Perec, J’aime, je n’aime pas; in: Revue L’Arc, no 76: Georges Perec, Aix-en-Provence 1979, S. 39 – und darin, in Truffauts Film also, jene Szene, in der Oskar Werner als Feuerwehrmann Montag, der in einer Gesellschaft, in der das Lesen verboten, dafür zu sorgen hatte, daß versteckte Bücher gefunden und samt und sonders verbrannt und ihre Leser der Justiz übergeben wurden, eines Tages dem Reiz des Verbotenen nicht mehr widerstehen konnte und während eines Einsatzes heimlich ein Buch an sich nahm und es in seinem Heim versteckte. Eines nachts dann, während seine Frau schlief, schlich er sich mit dem geretteten Buch, einem rot eingebundenen Duodezbändchen, ins Wohnzimmer, schlug es auf und begann, der Kulturtechnik ›Lesen‹ ungeübt, im Licht der Fernsehwand mit dem Finger die Buchstabenreihen entlang fahrend und sie dabei laut artikulierend: »The personal history of David Copperfield by Charles Dickens with illustrations by Phiz London Chapman and Hall Limited and Humphrey Milford New York Oxford University Press The American branch thirtyfifth west thirtythird street David Copperfield Chapter one I am born Whether I shall turn out to be the hero of my own life or whether that station will be held by anybody else these pages must show.« Die Kamera folgte seinem Finger noch eine Weile die Zeilen entlang und der Modulation seiner Stimme war zu entnehmen, daß Montag allmählich das Mysterium des Lesens aufging, nämlich daß die Buchstabenfolge »Whether I shall turn out to be the hero of my own life« einer anderen Welt angehörte als jener der Wörter »London, Chapmann and Hall Limited and Humphrey Milford«. Genette sollte es dann zukommen, der Buchstabenfolge »London, Chapmann and Hall Limited and Humphrey Milford« zu der ihr über das Merkantile hinaus angemessenen Bedeutung zu verhelfen. Offensichtlich ist auch hier bei diesem Text, wie bei Montags erstem Leseversuch, der Unterschied zwischen der Buchstabenfolge »Whether I shall turn out to be the hero of my own life« und »London, Chapmann and Hall Limited and Humphrey Milford« aufgehoben. Es gibt nur noch die Buchstaben, die sich zu den Wörtern zusammenfügen, die sich zu dem Text zusammenfügen, »Les mots, du reste, ont fini de jouer«, wie Breton es ausgedrückt hatte, »les mots font lʼamour«, (André Breton, Les mots sans rides; in: Les pas perdus, Paris 1924). »This is the first verse«, sang Robert Wyatt mit der gleichen Intention, die erste Strophe einleitend, und dann: »And this is the chorus«, und weiter, zu Beginn der zweiten Strophe: »This ist the second verse …« (Matching Mole (1972); hier: Signed Courtain). Die Verlinkung verweist auf die Verfügbarkeit der zitierten Musik bei einem Dienstleister, der gegen Entrichtung eines monatlichen Obolus Musik digitalisiert zum Abruf bereitstellt. Die Umstellung vom monatlichen Kauf von technisch reproduzierter Musik im Wert von rund zwanzig Euro – das vorhandene Budget – hin zu dem ungefähr die Hälfte kostenden Abonnement eines digitalen Dienstleisters kam einer größeren Revolution gleich, als man vermuten könnte. Denn der digitale Dienstleister stellte nahezu – auf dieses ›nahezu‹ wird später vielleicht noch zu sprechen kommen sein – ein musikalisches Schlaraffenland bereit, eine »Fülle des Wohllauts«, wie Thomas Mann es in Der Zauberberg (Frankfurt am Main 1986, S. 883ff.) bezeichnet hatte, mit all den angenehmen wie bedenklichen Wirkungen, die ein Aufenthalt in solch einer Region mit sich brachte. Nicht daß man sich an Musik überfressen könnte, aber einer stets im Prekären lebenden Hörerin oder einem Hörer in diesen Verhältnissen verlangte die erkaufte Musik eine andere Aufmerksamkeit ab, man war notgedrungen kritischer bei der Auswahl und man gab, so traurig das war und immer unter der Voraussetzung, daß man nicht professionell hörte, dem, für das man bezahlt, einen größeren Vertrauensvorschuß und billigte ihm ein größeres Quantum an hermeneutischer Geduld zu – den gleichen Effekt hatte Hans Blumenberg für die Finanzierung wissenschaftlicher Forschungsprojekte pointiert auf die Formel gebracht: »Wer investiert hat, glaubt länger.« (Abschaltung der Antennen; in: Die Vollzähligkeit der Sterne, Frankfurt am Main 2000, S. 401); an anderer Stelle hatte er im gleichen Kontext den Effekt als »Realismusindiz« bezeichnet: »denn wenn einmal Geld gegeben worden ist, darf es nicht verloren sein« (Auf der Suche nach höheren Intelligenzen; in: ebd., S. 4). Man war ja auch erst Schriftstellerin oder Schriftsteller, wenn man für das Geschriebene Geld bekam oder zumindest für den Druck nicht selber aufkommen mußte. Jedenfalls: so nun wurde die Musik durch ihre wohlfeile Verfügbarkeit flüchtiger, als sie es eigentlich vielleicht war. Da stellte sich natürlich die Frage, ob man einen ersten Eindruck eher zum positiven oder zum negativen hin korrigierte. Thomas Mann, um ihn nochmals anzuführen, hatte am Sonntag, dem 31. Oktober 1920, in seinem Tagebuch notiert: »Um Musik zu genießen, muß ich sie oft gehört haben, genau kennen.« (Thomas Mann, Tagebücher, hrsg. von Peter de Mendelssohn, Frankfurt am Main 1977ff., Bd. 1, S. 474). Da war etwas dran … aber im Kino war es umgekehrt, da ging man in den dunklen Raum, um sich von dem Unbekannten – tunlichst hatte man vermieden, im Vorfeld mehr als notwendig über den Film, auf den man sich einlassen wollte, zu erfahren – überraschen zu lassen. Es gab ja sogar eine Menge Filme, die nur über den Überraschungseffekt an ihrem Ende vollkommen funktionierten, Fritz Langs The Woman in the Window (1944) etwa oder Clouzots Les diaboliques (1955) oder Wilders Witness for the Prosecution (1957) oder Herk Harveys Carnival of Souls (1962) und Christian Petzolds Remake Yella (2007) oder Chabrols Alice ou la dernière fugue (1977) oder Jarmuschs Dead Man (1995) oder The sixth sense von M. Night Shyamalan (1999) … Jedenfalls: war das Hören von Musik früher so gewesen, wie wenn man mit dem Fahrrad zu dem See in der Nähe fuhr und ihn immer an der gleichen Stelle durchschwamm, so war es nun, wie wenn man sich in einen großen mitreißenden Strom begab, dabei bemüht, wenigstens manchmal Heraklit Lügen zu strafen, wozu aber, weil die Kunst lang – von Grateful Dead zum Beispiel gab es wohl mehr als zweitausend meist mehrstündige Konzertmitschnitte, und jedes Konzert war unmittelbar zu Gott, oder John Zorn, dem Godard der Musik, der fast jeden Monat mindestens ein neues Album publizierte – und das Leben kurz, die Zeit … »Man könnte großzügig ohne Maß sein, wäre nicht das Leben, das zur ›Rationierung‹ der Zeit […] zwingt.« (Hans Blumenberg, Zeitbedarfsrahmen; in: Die Vollzähligkeit der Sterne, a. a. O., S. 98). Andererseits, um auf den digitalen Dienstleister zurückzukommen, wurde man von dessen Algorithmen, die einem ›Vorschläge‹ unterbreiteten, die zwar manchmal abstrus, in der Regel aber nicht völlig aus der Luft gegriffen waren, häufig auch mit seiner eigenen Hörhistorie konfrontiert – als seien die aktuellen musikalischen Präferenzen das Resultat einer nachvollziehbaren Entwicklung – und man konnte auch aktiv selber ausprobieren, was von früher, was von dem längst vergessen geglaubten aktuell noch funktionierte. Ästhetische Zustände konnten sich dabei einstellen, in denen man in another land – sich dabei geschlechtlich zuneigend … l’après-midi d’un faune … – regredierte … Es gibt also, wie gesagt, hier jetzt nur noch die Buchstaben, die sich zu den Wörtern zusammenfügen, die sich zu dem Text zusammenfügen, ohne Ariadnes Hilfsmittel, woraus sich aber keine Digressionen in der Manier Sternes ergeben, denn es gibt ja, wie gesagt, nichts, von dem abgewichen werden könnte, es ist eher wie bei Buñuels Le fantôme de la liberté (1974), wo eine der vorherigen Figuren allein das Gelenk zum nächsten Abschnitt gewesen war – die Abfolge bildet aber nicht wie bei Schnitzler einen Reigen, sondern eine mehr oder weniger lineare Reihe, weil am Ende ›Ende‹ stehen wird –, wobei es hier jetzt weniger Figuren denn Aspekte sind, die überleiten. Man kennt solches vielleicht auch vom Lesen, wenn man nicht nur einen Text liest, sondern häppchensweise viele Texte quasi parallel, man beginnt, zum Beispiel, solch eine Lesesession mit einem Text über fernöstliche Liebeskunst, bei der man mit Unverständnis gepredigt bekommt, der Mann solle beim Liebesakt möglichst die Ejakulation vermeiden, dann liest man in der Storia della Bellezza a cura di Umberto Eco (Milano 2004) von der Notwendigkeit von Monstern in Gottes Schöpfung, dann liest man von amüsanten, aber etwas befremdlichen Bräuchen am kaiserlichen Hof im Kopfkissenbuch der bezaubernden Hofdame Sei Shōnagon, dann liest man von einem sexuellen Traum Georges Perecs in dessen La boutique obscure. 124 rêves (Paris 1973), dann liest man mit Erstaunen einen surreal anmutenden Abschnitt aus der neuen erweiterten neunten Auflage von Ernst Blochs Spuren (Frankfurt am Main 1995), der sich wie eine Fortsetzung von Perecs Traumgeschichten liest, dann liest man weiter in William S. Burroughs Naked Lunch (Paris 1953) und schließlich journalistische Texte des jungen Thomas Bernhard, der da noch nicht Thomas Bernhard gewesen, über moderne Kunst, die übergangslos gleichsam den Charakter von den Traumgeschichten Perecs annehmen … die Texte verlieren bei dieser Art zu Lesen ihre Eigenständigkeit und verschmelzen zu einem allgemeinmenschlichen Gestammel. – Wie dem auch sei, jedenfalls neben den beiden eingangs explizit genannten Quellen hat sicher auch noch die Lektüre der Romane von Beckett bei der Idee zu dieser Buchgestaltung mitgewirkt, wobei es, wie gesagt, hier jetzt Aspekte die Letztelemente sind, keine Figuren, seien sie auch noch so rudimentät, kein Molloy, kein Mallone und noch nicht einmal ein Namenloser. Wie sinnhaft erscheint uns doch heute das vormals als sinnfrei geltende! Und sicher auch mitgewirkt hat die Lektüre der Romane und Theaterstücke von Thomas Bernhard … die beiden … wie bei Kant: die Kritik des reinen Absurden und die Kritik des praktischen Absurden … Aber auch bei dieser Disposition – »Qu’importe qui parle, quelqu’un a dit qu’importe qui parle.« (Beckett) – könnte man noch folgenden Einwand anbringen – le style doit indiquer qui parle: »Mit der Konstruktion von richtigen Sätzen ist es nicht getan. Oft muß man sogar selber kommen. Die Position, von der man aus wirkt, ist nicht ohne Bedeutung […] Wo und wie man publiziert, sollte aus souveräner Verfügung über die Möglichkeiten entscheidbar sein oder zumindest als Selbstdarstellung mitbedacht werden …« (Niklas Luhmann, Die Praxis der Theorie; in: Soziologische Aufklärung 1, Opladen 1970, S. 264). Aber hier jetzt wird das Thema nicht behandelt, »larvatus prodeo.« (Descartes), und das wunderbare Versprechen des fertigen Buches, wie sich Georges Perec in einem Brief vom 16. Juni 1957 an seinen Cousin Henri Chavranski ausdrückte, wird hier nicht erfüllt, es sei denn, man bezeichnete das, was am Ende vorliegt, nachdem man im Sinne der trivialen Empfehlung, so zu leben, als sei jeder Tag der letzte, so geschrieben, als sei jeder Satz der letzte, als fertig. – Es gibt übrigens mittlerweile einen Vorschlag für ein neues erstes Motto: »Es ist äußerst behaglich, nachdem man abends gut gelebt – am Morgen so fortzufahren.« (Thomas Mann, Tagebücher, a. a. O., Bd. 1, S. 429; der Eintrag stammte vom Samstag, dem 1. Mai 1920). – And now for something completely different (Monty Python) … · Impressum: Herbert Neidhöfer ·TEXT. Ein Text · gegebenenfalls die Nummer des Bandes · August 2021ff. · Name des Verlags, Verlagsort und Erscheinungsjahr, gegebenenfalls Auflagennummer und Jahr der Neuauflage, ISBN-Nummer · Preis in Euro · Ende.
* »ungewöhnliche Buchgestaltung« meint hier, daß die im Text erwähnte Aufhebung der Differenz von Text und Paratext auch optisch sichtbar wird, wie dies anhand des am 11. November 2023 vorhandenen Textes erstellte Muster des Einbandes, bei dem sich auf der Vorderseite die erste Seite des Textblocks, in den das Titelblatt integriert ist, und auf der Hinterseite die letzte Seite des Textblocks mit integriertem Impressum, illustrieren soll …